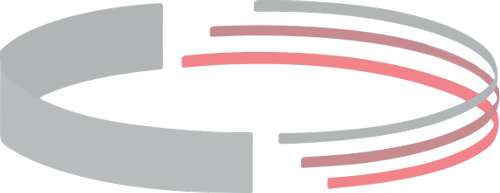Soziale Lage
Statistisch betrachtet sind ein niedriges Bildungsniveau, Armut, soziale Ausgrenzung und eine schwierige Integrationsperspektive Risikofaktoren für die Anwendung von Gewalt als erzieherischem Mittel. Hiervon sind (türkische) Migrant*innen überdurchschnittlich betroffen. Dementsprechend zeigen Studien (Pfeiffer/Wetzels 2000), dass sich die Raten innerfamiliärer Gewalt zwischen deutschen und in Deutschland lebenden zugewanderten Familien deutlich unterscheiden, auch wenn die zugewanderten Familien schon längere Zeit in Deutschland leben. Anstatt einer zu erwartenden allmählichen Angleichung des Gewaltniveaus kann sogar eine Zunahme der Gewalt mit der Dauer des Aufenthalts. Möglicherweise hängt dies auch mit den dauerhaften Anforderungen und Belastungen des Akkulturationsprozesses zusammen.
Gleichzeitig ist davon auszugehen, „dass im deutschen kulturellen Kontext sowohl körperliche Bestrafung von Kindern als auch die physische Gewalt innerhalb der partnerschaftlichen Beziehung gesellschaftlich weniger gebilligt wird als im herkunftskulturellen Kontext türkischer Familien“ (Uslucan u.a. 2015, S. 69f.).
Äußere Umstände in Gemeinschaftsunterkünften
Studien (z. B. die Situationsanalyse zur „Gewalt in den Gemeinschaftsunterkünften für Asylsuchende im Land Brandenburg“ des Fachberatungsdienst Zuwanderung, Integration und Toleranz im Land Brandenburg, o. J., S. 7) weisen auf einen Zusammenhang zwischen einer länger andauernden „angespannten Situation“ in Gemeinschaftsunterkünften und der Häufigkeit von Gewalt, darunter auch familialer Gewalt, hin. Für Kinder und Jugendliche bestehen bislang keine ausreichenden Schutzkonzepte in Gemeinschaftsunterkünften.
Rechtliche Regelungen
Die vielen äußeren Abhängigkeiten stellen insbesondere zu Beginn eine große Belastung dar. Die Regelungen verändern sich dabei immer wieder, je nach politischer „Stimmung“, z. B. in Bezug auf die Bleibeperspektive oder den Familiennachzug. Diese Ohnmachtserfahrungen sind insbesondere für Menschen mit Traumafolgestörungen sehr belastend, da die bereits erlebten überwältigenden Ohnmachtsgefühle wieder aktualisiert werden. Zusätzlich sind Familien mit Fluchterfahrung einem erhöhten Risiko verschiedener Formen von Diskriminierung ausgesetzt, sowohl in der Öffentlichkeit als auch institutionell und strukturell, z. B. bei der Arbeit bzw. Arbeitssuche, in der Schule oder beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen (vgl. Abdallah-Steinkopff 2018, S. 22f.; Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2018). Dies kann Impulsdurchbrüche und aggressives Verhalten fördern.
Konsequenzen für die Gewaltprävention
Der Blick auf die Lebensbedingungen verdeutlicht, wie wichtig die psychosoziale wie auch die (verfahrens-)rechtliche Unterstützung der Eltern bzw. der Familie ist, um sie beim Umgang mit den Behörden und den rechtlichen Klärungen nicht allein zu lassen. Bei einer Überforderung der Eltern sollten vorhandene Ressourcen zur Entlastung aktiviert werden, ggfs. auch durch professionelle Angebote.
Möglichkeiten zur Stärkung der Selbstwirksamkeit, z. B. durch Zusammenschlüsse mit anderen Geflüchteten oder Zugewanderten oder durch Migrantenselbstorganisationen, sollten unbedingt gefördert werden. Gleichzeitig wird deutlich, dass Gewaltprävention immer auch politisch sein muss und Verantwortliche für die Folgen der bestehenden Strukturen und Verfahrensweisen sensibilisiert und zu Veränderungen bewegt werden müssen.