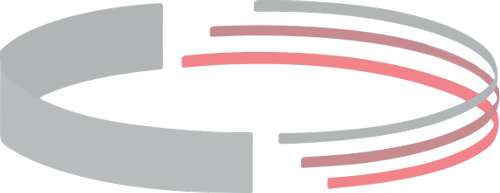Erziehungsvorstellungen in traditionellen kollektivistischen Gesellschaften
Die Vorstellungen zu Erziehung und das Erziehungsverhalten von zugewanderten Familien sind, besonders in der ersten Zeit nach der Ankunft, hauptsächlich durch die Erstsozialisation in den Herkunftsgesellschaften geprägt. Die dortigen Erziehungsideale stehen teilweise im Gegensatz zu westlichen pädagogischen Konzepten. So besteht beispielsweise in traditionellen verbundenheitsorientierten Gesellschaften eine auf gemeinschaftliche Zusammengehörigkeit ausgerichtete Vorstellung von Erziehung (vgl. Abdallah-Steinkopff 2018, S. 37). Hier ist das Lernen am Modell der Erwachsenen zentral. Wichtige Werte sind „Respekt vor Erwachsenen, Gehorsam und die Orientierung an einer religiösen Moralvorstellung“ (Abdallah-Steinkopff 2018, S. 35). Es gibt klar vorgegebene Regeln und Pflichten. Werden diese nicht eingehalten, folgen Sanktionen. Eigene individuelle Empfindungen, Ansichten oder Wünsche werden dem Wohl des familiären Verbunds bzw. der Gemeinschaft untergeordnet (vgl. Kizilhan 2013, S. 27). Traditionell-verbundenheitsorientierte Erziehungsideale sind nicht zwangsläufig mit Gewalt als Erziehungsmittel verbunden, können jedoch eine Legitimationsgrundlage dafür sein und diese begünstigen.
Einfluss der erlebten Gewalt der Eltern
Selbst erlebte familiäre Gewalt in der Kindheit – dazu zählt auch die Gewalt zwischen den Eltern – führt unabhängig von der Art des familiären Zusammenlebens zu einem höheren Risiko, später selbst Gewalt auszuüben. „Besonders wichtig sind in lern- und bindungstheoretischer Sicht dabei Konfrontationen mit innerfamiliärer Gewalt als möglicher Form der Konfliktaustragung.“ (Pfeiffer et al. 1999, S. 4).
Fehlende Konfliktkompetenzen und eigene innerfamiliäre Gewalterfahrungen in der Kindheit begünstigen somit neben familialen Belastungen gewalthaltige Übergriffe gegenüber den eigenen Kindern (vgl. Bussmann 2007, S. 646). Gewalt innerhalb der Familie hat somit häufig transgenerationale Auswirkungen.
Überhöhte Bildungsaspirationen
Als ein Einflussfaktor auf Gewalt gegen Kinder gelten auch überhöhte bzw. unrealistische Erwartungen der Eltern gegenüber den Kindern. Diese lassen sich bei zugewanderten Familien (hier aus der Türkei) verstärkt in Bezug auf den Bildungserfolg ihrer Kinder beobachten. Einerseits hohe Erwartungen der Eltern an die Kinder und andererseits kaum schulische Unterstützungsmöglichkeiten durch die Eltern führen bei den Kindern bzw. Jugendlichen oft zu Frustration. Vermutlich aus Unkenntnis der verschiedenen Wege des sozialen Aufstiegs in Deutschland, auch nach einem Hauptschul- oder Realschulabschluss, betrachten es zugewanderte Eltern als erzieherische Aufgabe, für den Schulerfolg und eine möglichst akademische Laufbahn zu sorgen. Können die Kinder diesen überhöhten Erwartungen nicht gerecht werden, reagieren die Eltern oft mit Enttäuschung. Die Kinder bzw. Jugendlichen können auf die daraus folgende psychische Belastung mit aggressiven oder depressiven Verstimmungen reagieren. Daraus kann sich eine gewaltvolle Eltern-Kind-Interaktion ergeben. Hier kann es ein gewaltpräventiver Ansatz sein, die Eltern über verschiedene Wege des sozialen Aufstiegs in Deutschland zu informieren sowie über die negativen Folgen der Überforderung durch überhöhte Ansprüche aufzuklären. (vgl. Uslucan 2014, S. 316)
Jugendliche Mütter bzw. Eltern
Verfügen die Eltern, insbesondere die Mutter, nicht über ausreichende Erziehungs- und Pflegekompetenzen, kann dies zu Gewalt gegen das Kind führen. Insbesondere bei jugendlichen Müttern bzw. Eltern ist hierfür das Risiko hoch. Sie haben weniger Kenntnisse z. B. über das Entwicklungstempo von Kindern oder darüber, welche kindliche Verhaltensweisen entwicklungsgemäß sind, und sind weniger feinfühlig im Umgang mit dem Säugling oder Kleinkind. Oft brauchen sie selbst noch Unterstützung und sind durch die Erziehungsaufgabe überfordert.
Für junge Migrantinnen ist das Risiko einer frühen Mutterschaft höher als für deutsche. „Nicht selten ist in Beratungs- und Therapiekontexten zu erleben, dass junge Frauen […] mit knapp 18 Jahren geheiratet haben (oder verheiratet wurden) und im Alter von 20 bis 25 Jahren zwei und mehr Kinder zu versorgen haben. Vor diesem Hintergrund ist bei der Beratung von Migranteneltern eine tiefergehende Aufklärung über die Risiken der Frühverheiratung und der frühen Schwangerschaften – sowohl für die Mutter wie für das Kind – vonnöten.“ (Uslucan 2014, S. 318 f.).