Was ist bei transkultureller Kommunikation wichtig?
Erfahrungen werden entsprechend des sprachlich-kulturellen Kontexts gemacht und bewusst und unbewusst gespeichert. Für den Austausch darüber und die Bearbeitung im Hilfegespräch ist ein Rahmen wichtig, in dem nicht nur das Gesagte, sondern auch das Gemeinte, also auch die kulturell geprägten Konnotationen und Ausdrucksformen, verstanden werden können.
Verschiedene kulturelle Hintergründe
Haben die Gesprächspartner*innen verschiedene kulturelle Hintergründe, kann es ansonsten aufgrund unterschiedlicher Denkart und der unterschiedlichen Bedeutungszuschreibungen von Wörtern und Handlungen, wie Gestik und Mimik, Betonung, Lautstärke und Stimme, Nähe und Distanz etc. zu Schwierigkeiten oder gar Missverständnissen kommen.
Das Gespräch – ein transkultureller Raum
Wechselseitige Veränderungsprozesse
Sich verständigen ist ein komplexer Prozess, in dem die jeweiligen kulturellen, sozialen, religiösen und biografischen Prägungen von Menschen von großer Bedeutung sind. Im Hin und Her des Gespräches treffen in Worten, Mimik und Gestik unterschiedliche Bezugsfelder aufeinander und gehen in Resonanz oder Dissonanz miteinander. So werden Veränderungsprozesse für alle Gesprächsteilnehmer*innen angestoßen, sei es ein Lernen, sei es Abwehr, seien es Übernahmen o.ä. Dies gilt für jedes Gespräch, wird aber besonders eklatant, wenn Menschen aus unterschiedlichen Kulturen sich begegnen. Der Ansatz der Transkulturalität unterstreicht die Prozesse wechselseitiger Veränderung. Er betrachtet Kulturen nicht als abgeschlossene Einheiten, sondern geht von stetigen Vermischungsprozessen aus, bei denen sich alle Seiten verändern. Im Gespräch von Menschen unterschiedlicher Kultur entsteht ein transkultureller Raum.
Gruppenzugehörigkeit und Individualität
Für die Praxis bedeutet dies, dass ein gemeinsames Verständnis oder gemeinsame Werte, Normen, etc. nicht als selbstverständlich vorausgesetzt werden können, selbst bei gleicher regionaler Herkunft, sondern je individuell erfragt, nachvollzogen bzw. verstanden werden müssen.
Die Bedeutung sozialer Unterschiede
- Alter
- Bildungshintergrund
- körperliche Fähigkeiten
- kulturelle oder religiöse Zugehörigkeit
- berufliche Qualifizierung
- Geschlecht
- sexueller Orientierung etc.
Bei Migrant/-innen und Migrantengruppen entstehen Unterschiede zudem durch:
- Migrations- und Rechtsstatus
- Zeitpunkt der Einwanderung (vgl. Meier-Braun 2015).
Diversität: Chance und Risiko - Vielfalt und Vorurteile
Diversität betont die Vielfalt der Unterschiede und macht aufmerksam, dass nationale, kulturelle, ethnische oder religiöse Merkmale nur Teilaspekte sind, um Menschen und Gruppen zu beschreiben. Sie kann Menschen dazu führen, neugierig zu sein und Vielfalt als Bereicherung wertzuschätzen. Diversität kann aber auch verunsichern, Fremdheit kann Angst machen, so dass Tendenzen zur Minimierung der Unterschiede und zur Ablehnung und Abwertung stark werden, insbesondere durch Stereotype und Vorurteile. Daraus folgen Diskriminierungsprozesse.
Missverständnisse sind Chancen zum Lernen
Spezifika transkultureller Kommunikation
In Deutschland leben viele Menschen mit Migrationshintergrund familienorientiert (= kollektivistisch). Dies betrifft vor allem Menschen mit einem orientalischen Hintergrund. Was bedeutet das für die Arbeit in der Beratung mit diesen Menschen? Hier finden Sie Tipps zum Umgang mit familienorientierten Menschen aus kollektivistischen Gesellschaften.
- Was sind typische Verhaltensmerkmale in kollektivistischen Gesellschaften?
- Welche Folgen hat das für die Beratung und die Beziehung zwischen Beratenden und Klienten?
- Welche Missverständnisse können entstehen und wie kann man sie vermeiden?
Gesprächsteilnehmer
Warum?
Bei KlientInnen anderer Kulturen, vor allem aus familienorientierten Gesellschaften, wollen die mitgekommenen Verwandten oft mit dabei sein. Was sollte man als beratende Person dann tun?
- Anliegen der Familie oder Verwandten akzeptieren
- Alle Personen in Beratungszimmer nehmen
- Verwandte und Familie in Erstgespräch einbeziehen
Warum sollte die beratende Person das tun?
- Menschen aus kollektiv orientierten Strukturen sehen und fühlen sich als Teil eines sozialen Systems.
- Konzepte über das ‚Ich‘ sind kollektiv in Verbindung mit den anderen ausgerichtet.
Höflichkeitsregeln
Respekt:
Diesen äußert man, indem man einen gewissen Raum für Intimität zulässt. Gleichzeitig hält man ausreichend Distanz ein. Respekt zeigt man auch, indem man kulturelle Regeln einhält. Das ist zum Beispiel das Aufstehen, wenn die andere Person den Raum betritt oder verlässt.
Freundlichkeit:
Diese äußert sich durch Zugewandtheit und Aufmerksamkeit im Kontakt. Gleichzeitig wartet man auf Anweisungen und Vorgaben seines Gegenübers. Das bedeutet: Gegenüber der beratenden Person sind die KlientInnen eher zurückhaltend.
Harmonie:
Einmal warten KlientInnen auf die Anweisungen und Vorgaben auf die beratende Person. Gegenüber diesen gibt es keine Widersprüche, zum Beispiel durch eine (Gegen)Argumentation. Das bedeutet: Die KlientInnen vermeiden meistens Konfrontation. Das wiederum bedeutet: Vermeidung und Verdrängung kann eine wirksamere Bewältigungsstrategie als bei individualistischen Gesellschaften sein.
Erst der Körper:
Thematisiert man Probleme, fragt man immer zuerst nach körperlichen Beschwerden – nicht nach seelischen. Warum? Körperliche Beschwerden sind viel weniger schambesetzt als psychologische Probleme. Also gilt das Credo: ‚Zuerst der Körper, erst dann die Seele!‘.
Kommunikation und kollektivistische Gesellschaften
Welche Rolle spielen diese Punkte im Alltag? Wie äußern sich diese Punkte im Alltag?
Alltag + Beziehung
→ KlientInnen sind sehr beziehungsbezogen und personenzentriert. Das bedeutet: Der Beziehungsaufbau ist im Vordergrund. Hier spielen Rituale eine große Rolle.
Alltag + eigene Person
→ Gefühle und Emotionen sind mehr im Vordergrund. Als KlientInnen spricht man sehr bildhaft von sich und über seine Familie.
Alltag + Hierarchie
→ KlientInnen halten tendenziell eine Rangordnung ein. Der Grund: Sie sind sehr harmoniebedürftig und vermeiden Konfliktverarbeitung. Für die Beratung kann das zum Beispiel Folgendes bedeuten. KlientInnen widersprechen der beratenden Person eher selten und übernehmen tendenziell zunächst weniger die Initiative.
Alltag +Körpersprache
→ Es gibt mehr Ausdruck durch Mimik und Gestik. Körperhaltungen sind Ausdruck von indirekt mitgeteilten Botschaften.
Alltag + Geschlecht
→ Oft gibt es geschlechtlich getrennte Kommunikationswelten.
Alltag + Sachinformation
→ Sachthemen werden ‚nebenbei‘, indirekt auf ‚Umwegen‘ und ‚intuitiv angesprochen. Im Vordergrund steht Persönliches und die Beziehung.
Erwartungen an mich
Um einen Umgang zu finden und sein Verhalten auf die KlientInnen einzustellen, muss man folgende Erwartungen, die an einen gerichtet sind, kennen:
Ratschläge und klare Direktive:
Meistens erwarten KlientInnen Lösungen bzw. Informationen von der beratenden Person. Das bedeutet: Die KlientInnen erwarten von der beratenden Person klare Anweisungen.
Zeit und Geduld:
KlientInnen aus orientalisch patriarchalischen Gesellschaften brauchen zu Beginn mehr Zeit ihre Sicht und Geschichte zu erzählen. Fordert die beratende Person auf ‚auf den Punkt zu kommen‘, fühlt sich das für die KlientInnen oft als Kränkung an. KlientInnen haben hier das Gefühl, abgelehnt zu sein.
Fokus auf Beziehung:
In familienorientierten Gesellschaften ist die Beziehung zu anderen Menschen überhaupt bedeutsam. Das schließt die beratende Person ein. Deshalb schätzen diese KlientInnen persönliche Eigenschaften der beratenden Person mehr als das Fachwissen.
Wichtige Eigenschaften sind hier …
- Verständnis
- Geduld
- Respekt
- Höflichkeit
- Aufmerksamkeit
- Freundlichkeit
- Offenheit
Umgang mit Unsicherheiten der Klient*innen
Besonderheiten bei Kindern
Im Folgenden finden Sie kurze Erklärungen und Hinweise.
Welchen sozialen Umgang lernen Kinder aus familienorientierten Gesellschaften?
- eigene Eltern nie bloßstellen
- Meinung der Eltern nicht in Frage stellen
- nicht auf Verwandte oder Familienmitglieder ‚böse‘ sein
- keine Konfrontation mit Verwandten oder Familienmitglieder suchen, die einen Fehler gemacht haben
Was sind die Gründe für diesen sozialen Umgang?
Die Angst vor einem Gesichtsverlust beeinflusst den sozialen Umgang. In traditionell familienorientierten Gesellschaften ist es deshalb wichtig, das eigene Gesicht und das Gesicht von Familienmitgliedern oder Verwandten zu wahren oder zu schützen. Kinder lernen einmal, in ‚Wir-Begriffen‘ zu denken. Das ‚Wir‘ ist das Kollektiv. Kinder lernen auch, dass sie das ‚Gesicht (des Kollektivs) wahren‘, wenn sie die obigen sozialen Regeln einhalten. Kinder (und auch Erwachsene) erfahren Ablehnung, Bestrafung oder Ausgrenzung durch das Kollektiv, wenn sie die obigen sozialen Regeln nicht einhalten.
Welche Herausforderungen erleben Kinder im Kontakt mit einer ‚zweiten Kultur‘?
Oft nehmen Kinder das Zusammentreffen von Herkunfts- und Aufnahmekultur unbewusst als unüberwindbare Barriere wahr. Hier haben sie das Gefühl, sich für eine der beiden Kulturen entscheiden zu müssen. Das verstärkt innere Konflikte
Wie kann man mit dem kulturbedingten Hintergrund der Kinder konstruktiv umgehen?
‚Alternative‘ Kommunikationsformen können helfen. Was bedeutet ‚alternativ‘?
- Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, ein Blatt Papier zu benutzen. Hierauf können Kinder malen oder zeichnen. Bilder und Zeichnungen helfen den Kindern, sich angesichts der obigen Regeln auszudrücken.
- Konkrete Gegenstände können ebenfalls benutzt werden. Gegenstände können zum Beispiel ein Gefühl des Kindes repräsentieren
Arbeit mit Sprachvermittler*innen
„Die Sprache ist eine Verkörperung des Seelenlebens.“ (Norbert Elias)
Dieser Ausspruch veranschaulicht die Bedeutung der Sprache und die Notwendigkeit ausreichend guter sprachlicher Verständigung als Voraussetzung für die Begleitung von Menschen. Je nachdem ob ein Gespräch in der Erstsprache oder in einer später erworbenen Sprache geführt wird, sind der (emotionale) Zugang und die Ausdrucksmöglichkeiten der Erfahrungen unterschiedlich. Die frühkindlichen Prägungen, die durch die Interaktion mit den primären Bezugspersonen vermittelt und deshalb mit der Muttersprache assoziiert sind, sind über die Zweitsprache schwerer zugänglich.
Wann braucht es Sprachvermittler*innen?
Auf welche Fähigkeiten muss ich bei der Auswahl achten?
Kultur- und Sprachkenntnisse
Die Sprachvermittler*innen müssen in der Lage sein, Formen des Erlebens, Denkens und Verhaltens aus der einen Kultur in eine andere sprachliche und kulturelle Welt zu übertragen. Das Verständnis in der interkulturellen Kommunikation ist nur dann gewährleistet, wenn den Sprachvermittler*innen beide Kulturen vertraut sind. Sie sind in der Regel bilinguale und bikulturelle Personen, die das Grundgerüst beider Kulturen gut kennen und neben einer Sprachvermittlung auch eine Brückenfunktion als Kulturvermittelnde einnehmen und dem Gespräch Sinn und Bedeutung geben können.
Spezifische terminologische Kenntnisse
Gerade im medizinisch-psychosozialen Bereich müssen die Sprachvermittler*innen ausreichende terminologische Kenntnisse in beiden Sprachen besitzen bzw. dazu geschult werden, damit sie auch die unterschiedlichen Krankheitsvorstellungen und -verhalten richtig vermitteln können. Somit ist über die gesprochene Sprache hinaus ein Wissen über die kulturspezifische Bedeutung von Fachbegriffen äußerst wichtig.
Psychische Stabilität, Empathie, Toleranz
Von Sprachvermittler*innen wird neben der Beherrschung beider Sprachen und der Kenntnis beider Kulturen auch Selbstbewusstsein, emotionale Stabilität, Toleranz für das „Andere“ sowie ein hoher Grad an Einfühlungsvermögen erwartet. Sie sollen die Gefühle des Gegenübers verstehen und respektieren, sich in die Lage, in der sich der bzw. die andere befindet, hineinversetzen und die Welt mit seinen bzw. ihren Augen sehen können. Auch wenn Denk- und Verhaltensweisen der Menschen, für die sie übersetzen, nicht nachvollzogen werden können, ist eine ausreichende Wertschätzung mit einer ausreichenden emotionalen Distanz notwendig.
Vermeidung belastender Konstellationen
Daher sollten bei der Sprachvermittlung, vor allem bei sehr persönlichen Belangen der Betroffenen, keine Verwandten oder Bekannten eingesetzt werden, vor allem keine Kinder. Haben Frauen oder Mädchen möglicherweise sexuelle Gewalt erlitten, sollten nach Möglichkeit weibliche Sprachvermittler*innen zur Verfügung gestellt werden. Dabei sollte auch auf den ethnischen und religiösen Hintergrund geachtet werden. So können z. B. Jesidinnen, die durch den IS schwer traumatisiert sind, auch arabisch-muslimischen Sprachvermittlerinnen gegenüber misstrauisch sein und nicht wirklich bereit sein, vor diesen über ihre Probleme zu sprechen. Dies ist vorher zu klären.
Welche Herausforderungen bringt die Beziehungstriade?
Gefahr von Loyalitätskonflikten
Sprachmittler*innen können von den beiden Seiten mit unterschiedlichen Erwartungen konfrontiert sein. Nicht wenige geflüchtete Menschen wünschen sich ein solidarisches Verhältnis von der Person, die „ihre Sprache spricht“. Dagegen erwarten die begleitenden bzw. helfenden Personen ein neutrales Verhältnis. So kann es zu Loyalitätskonflikten kommen, wenn z.B. die/der Klient*in die Sprachmittler*innen darum bitten, bestimmtes Gesagtes nicht zu übersetzen.
Die Beziehung zwischen Klient*in und beratender Person kann auch erschwert sein, wenn von Seiten der Migrantinnen und Geflüchteten ein Misstrauen zur/m Sprachmittler*in besteht (s.o. Beispiel Jesidin und muslimische Dolmetscherin).
Im beratenden und therapeutischen Gespräch wird daher versucht, über eine Sitzordnung und durch ein Einführungsgespräch derartige Irritationen zu vermeiden.
Welche Sitzordnung ist hilfreich?
Was ist im Einführungsgespräch mit der sprachvermittelnden Person zu klären?
- ihre Rolle und Aufgaben
- Inhalt, Zweck und die voraussichtliche Länge des Gesprächs
- die Schweigepflicht.
Eine klare Absprache kann helfen, Missverständnisse oder Gesprächsstörungen zu vermeiden.
Passive Rolle:
Der sprachvermittelnden Person muss bewusst sein, dass sie eine rein sprachvermittelnde Funktion hat und nicht eigene Ideen, Ratschläge oder Anregungen ergänzen oder der betroffenen Person Ratschläge geben darf, was diese während des Gesprächs sagen oder nicht sagen soll, ohne dass die Fachkraft davon Kenntnis hat. Das ist besonders zu beachten, wenn die sprachvermittelnde Person teilweise noch andere Rollen außerhalb des Sprachvermittelns ausübt, wenn sie z. B. selbst in einem sozialen Beruf tätig ist oder sich auch privat mit der Person trifft. Dies setzt gleichzeitig voraus, dass die/der Sprachmittler*in Vertrauen in die beratende oder therapeutisch handelnde Person hat (Hillebrecht 2019: 115)
Nicht-Verstehen signalisieren:
Sollten Sprachvermittler*innen das Gefühl haben, dass die betroffene Person die Informationen über die Vorgehensweise oder den Rahmen des Gesprächs nicht verstanden hat, ist die Fachkraft unmittelbar darüber zu informieren.
Zum Hintergrund: Unterscheidung Sprach- und Kulturvermittler*innen
Es gibt zwei konkurrierenden Konzepte zur Rolle von Dolmetschenden:
Worauf sollten Sprachvermittler*innen im Übersetzungsprozess achten?
Wortgenau, kommentarlos und unparteilich ist jede Äußerung zu übersetzen.
- In der Ich-Form sprechen: Die sprachvermittelnde Person spricht „als“ Person, die der Übersetzung bedarf und nicht „über“ dieselbe. D.h. Aussagen in der 3. Person, wie z.B. „Frau Awda sagt …“, sind zu vermeiden.
- In einem freundlichen und ruhigen Ton sprechen
- Lautstärke, Sprachebene, Redeweise (Wiederholungen, Stocken, Unvollständigkeit von Sätzen), Intonation sollten distanziert nachvollzogen werden. Denn die Art der Argumentation kann in verschiedenen Kulturen verschiedene Bedeutungen haben.
- Nicht aktiv eingreifen: Sprachvermittler*innen sollten nicht aktiv in das Gespräch eingreifen. Auch bei aggressiven, emotionalen oder sogar ordinären Bemerkungen ist zu übersetzen oder der emotionale Beiklang, den eine bestimmte Wortwahl mit sich bringt – wenn möglich – zu transportieren.
- Transparenz bei kulturspezifischen Differenzen, Redewendungen, Missverständlichem, Tabuthemen, Unübersetzbarem: Der Übersetzungsvorgang ist transparent zu machen (Kläui &Stuker 2010; Kluge 2017; Kizilhan 2017). Dies bedeutet:
– Redewendungen und Metaphern klären
– Auf Missverständliches und Unübersetzbares hinweisen
– Wenn ein Nichtverstehen beobachtet wird, so muss dieses angezeigt werden.
– Werden kulturspezifische Tabuthemen der Herkunftskultur angeschnitten, sollten Sprachvermittler*innen das Gespräch unterbrechen und entsprechend erläutern. - Störungen nicht kommentieren: Bei störenden Signalen, Tönen oder unangenehmen Gerüchen darf auf keinen Fall auffällig oder negativ reagiert werden, um die betroffene Person nicht in eine peinliche Lage zu bringen.
- Aktives Zuhören: Basis ist, aktiv und aufmerksam zuzuhören und sich ausschließlich auf das Gespräch zu konzentrieren.
Wie ist der Zeitrahmen zu planen?
In manchen Settings, wie Supervision oder Teamsitzungen, können Sprachvermittler*innen Teilnehmende sein. Auch hier muss ihre Rolle definiert sein und besprochen werden, inwieweit sie als Kulturvermittler*innen ihr Wissen an das Team weitergeben oder sich gar selbst an Fallanalysen beteiligen dürfen.
Welche Belastungen für Sprachvermittler*innen bringen Gespräche mit traumatisierten Menschen?
Es sollte ein Nachgespräch, eine Supervision oder eine andere Unterstützungsmöglichkeit angeboten werden.
Zusammenfassung wichtiger Aspekte – zum Download:
Angela Treiber: Empfehlungen für Dolmetschende und für die Zusammenarbeit von begleitenden Personen mit Dolmetschenden
Für eine sensible Auswahl des/der Dolmetscher/-in ist wichtig:
- Berücksichtigung der spezifischen Lebenssituation der begleiteten Person: z.B. Geschlecht, Alter, Herkunft, politische, religiöse Zugehörigkeit, Gewalterfahrung etc.
- Vorbesprechungen, die in die spezifische Situation und leitenden Fragestellungen einführen.
- eine klare Rollenvereinbarung der Beteiligten
- Klärung von Fachbegriffen und deren Übertragung in Umschreibungen.
- Während des Gespräches sollte die gesprächsleitende begleitende Person in kurzen klaren Sätzen formulieren, abstrakte Begriffe oder typische sprachbildliche Redewendungen vermeiden.
- Sie sollte Geduld haben, längeren Ausführungen zuzuhören und die Erzählenden ausreden lassen, Unterbrechungen durch den Dolmetscher tolerieren, Pausen zulassen.
- Nach dem Gespräch sollte erneut ein Austausch zwischen Dolmetscherinnen und begleitenden Personen über kultursensible Aspekte und Verstehensprobleme stattfinden.
Das Zuhören und Übersetzen von mitgeteilten dramatischen Ereignissen und traumatisierenden Erfahrungen (Kriegsereignisse, Gewalterfahrung, etc.) kann eine besondere Belastung für die Dolmetschenden darstellen. Gegenseitiger Erfahrungsaustausch in Nachgesprächen sowie regelmäßig in Supervisionen für Betreuer und Sprachmittler bieten hier Unterstützung.
Kompetenzen guten Dolmetschens
Grundsätzliche Unterscheidung:
Äquivalentes Übersetzen schließt die sukzessive Annäherung an das gemeinte durch Nachfragen ein. Wohingegen adäquates übersetzen selbstverständliche oder bewusst deutend Angleichungen oder Überdeckungen der einen oder anderen Position zur Folge haben kann und Informationen während des Übersetzens verloren gehen können. (vgl. Kruse/Schmieder 2008)
Kompetenzen:
- Einschlägige Sprachsicherheit
- Sachkompetenz ([Spezial]Wortschatz für die spezifische Gesprächssituation, zum Themenfeld Flucht- und Migrationsprozesse und -politiken, zu sozialen und politischen Situationen im Herkunftsland, zu rechtlichen administrativen Regelungen).
- Bewusstsein der eigenen kulturellen Prägung und deren Relativität gegenüber anderen Prägungen
- Wertneutralität und Mehrperspektivität
- psychosoziale Belastbarkeit
Voraussetzungen gelingender Dolmetscharbeit
- Ungleiche Begegnungen erkennen und transparent machen
- Selbstreflexion über die Haltung gegenüber Sprache und Kultur, über die Doppelrolle als Dolmetscher/-in und (Sprach)Mittler/-in/ Mediator/-in
- Analyse der subjektiven Wahrnehmung der eigenen Handlungs- und Wirkmächtigkeit
- Beachtung der Vermitteltheit der jeweiligen Informationen: Bewusstsein dafür, dass die Akteure auf die Übersetzungen und die Dolmetschenden reagieren, nicht direkt auf die Klient/-innen bzw. begleitenden Personen)
- Wissen um die prinzipielle Notwendigkeit der Übersetzungsprozesse für die Verständigung und das Caring, trotz aller Schwierigkeiten.
Vorbereitung und Grundhaltungen
Für ein Verstehen ist sowohl auf die Individualität als auch auf die Gruppenzugehörigkeit eines Menschen angemessen zu achten.
Informationen einholen
Fragende Grundhaltung
Transkulturelle Grundhaltungen
- Ehrlichkeit: Es hilft, Nicht-Wissen und Nicht-Verstehen zu benennen und mit ehrlichem Interesse nachzufragen.
- Wertschätzung der jeweiligen Prägungen (der eigenen und der anderen Person) und Annehmen der Andersartigkeiten sind eine elementare Basis des Gesprächs.
- Vertrauen in den Prozess einer ehrlichen Begegnung und Geduld ermöglichen Schritte der Verständigung und lassen gegenseitiges Vertrauen wachsen.
- Verständigung braucht von allen Seiten die Bereitschaft zu lernen (über sich und den/die Andere) und sich zu verändern
- Fehlerkultur: Dazu gehört auch das Eingeständnis von Fehlern und damit eine Selbstrelativierung.
Anregungen zur Selbstreflexion
Literatur
Geertz, Clifford (1987/2015): Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme. 13. Aufl., Frankfurt a. M.: Suhrkamp Taschenbuch.
Hillebrecht J, Roth L, Helmes A, Bengel J (2019): Die triadische Beziehung in der dolmetschergestützten Psychotherapie. Ergebnisse einer qualitativen Interviewstudie mit yezidischen Geflüchteten, Dolmetscherinnen und Psychotherapeutinnen. In: Junne F, Denkinger J, Kizilhan J, Zipfel S (Hg.) Aus der Gewalt des „Islamischen Staates“ nach Baden-Württemberg. Evaluation des Sonderkontingents für besonders schutzbedürftige Frauen und Kinder aus dem Nordirak. Weinheim: Beltz.
Kizilhan, Jan I. (2017): Patient form Middle East and the Impact of Culture on Psychological Pain-Treatment. Fibrom Open Access 2, S. 121.
Kläui H, Stuker R (2010): Interkulturelles Übersetzen in der Arbeit mit traumatisierten Menschen. In: Dahinden J, Bischoff A (Hg.) Dolmetschen, Vermitteln, Schlichten – Integration der Diversität? Zürich: Seismo, S. 138–146.
Kluge U (2017): Psychotherapie mit Sprach- und Kulturmittlern. In: Graef-Calliess IT, Schouler-Ocak M (Hg.) Migration und Transkulturalität. Neue Aufgaben in Psychiatrie und Psychotherapie. Stuttgart: Schattauer. S. 231–239.
Kruse J, Schmieder C (2008): In fremden Gewässern. Ein integratives Basisverfahren als sensibilisierendes Programm für rekonstruktive Analyseprozesse im Kontext fremder Sprachen. In: Kruse J, Bethmann S, Niermann D, Schmieder C (Hg.) Qualitative Interviewforschung in und mit fremden Sprachen. Eine Einführung in Theorie und Praxis. Weinheim und Basel: Beltz Juventa. S. 248-295.
Lersner, Ulrike von/Kizilhan, Jan Ilhan (2017): Kultursensitive Psychotherapie. Göttingen: Hogrefe Verlag.
Meier-Braun, KH (2015): Einwanderung und Asyl. Wichtige Fragen. München: CH Beck.
Morina, N (2007): Sprache und Übersetzung. In: Maier T (Hg.): Psychotherapie mit Folter- und Kriegsopfern. Ein praktisches Handbuch. Bern: Huber. 179–201.
Morina N, Maier T, Schmid-Mast M (2010) Lost in translation? Psychotherapie unter Einsatz von Dolmetschern. Psychotherapie, Psychosomatik, medizinische Psychologie 60, S. 104–110.
Moskowitz, Gordon B. (2005): Social Cognition: Understanding Self and Others. New York, London: The Guilford Press.
Salman, Ramazan (2015): Gesundheit mit Migranten für Migranten – die MiMi Präventionstechnologie als interkulturelles Health-Literacy-Programm. Public Health Forum, 23(2), S. 109–112.
Selvini Palazzoli, Mara/Boscolo, Luigi/Cecchin, Gianfranco/Prata, Giuliana (1981): Hypothetisieren, Zirkularität, Neutralität: drei Richtlinien für den Leiter der Sitzung. Familiendynamik 6, S. 123–139.
Westermeyer, Joseph (1987): Cultural factors in clinical assessment. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55(4), S. 471–478.
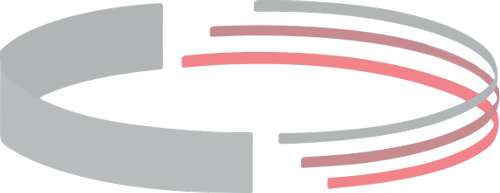
 Lersner U, Kizilhan J (2017) Kultursensitive Psychotherapie. Göttingen: Hogrefe.
Lersner U, Kizilhan J (2017) Kultursensitive Psychotherapie. Göttingen: Hogrefe.